Ruhe da vorne! Movie-Mania 2009 (75-79) Heute: White Buffalo, Butterfly Effect: Revelations, Wonder Woman, Role Models, American Swing
Themen: Film, TV & Presse, Movie-Mania 2009, Neues |White Buffalo

Ein Spätwestern, der als “Weißer Hai”-Variante verkauft wird? Darauf muss man erstmal kommen.
In der Tat beruht mein Interesse an “Der weiße Büffel” nur daran, dass ich mich an die Schlagzeile eines Bravo-Berichts zum Kinostart erinnern kann, die da lautete: “Bronson hat Angst!” Jau, sowas war damals ein Ausrufezeichen wert! Muss ja auch – wie Steven Seagal hat Bronson sonst schließlich nie Angst! NIE!
Nun ist der Spätwestern ja ein Genre, in dem Legenden wie John Wayne und Clint Eastwood nochmal richtig die Sau rauslassen konnten. Da wurden Mythen demontiert, und aus dem Italo-Western wurden Brutalität und Nihilismus übernommen. Man sollte meinen, dass Charles Bronson sich in dem Umfeld zu Hause fühlt – schließlich hatte er in “Spiel mir das Lied vom Tod” den Durchbruch des Italo-Westerns mitverantwortet.
Doch leider verlässt sich Bronson mal wieder auf seinen Stamm-Regisseur Thompson – und der ist eben kein Hill, Cimino, oder wenigstens Costner. Thompson hörte irgendwann in den 70ern auf, Filme mit mehr zu drehen als solidem Handwerk, und er war selbst dabei nie mehr als ein serviler Stichwortgeber für ego-geladene Altstars, die sich nicht gerne reinreden lassen. Von so einem Regisseur einen reifen Spätwestern mit solide gebauter Meta-Ebene zu erwarten, zeugt von Naivität.
So ist der “White Buffalo” denn auch ein außerordentlich kruder Film geworden – über weite Strecken ein existenzialistisches, aber sehr banal konstruiertes Melodram über das Ende der letzten Männerwelt, das für den viel zu kurzen Showdown in eine unwirtliche wie unwirkliche Studio-Schneelandschaft wechselt, wo unsere Helden mit einem mythischen Monster konfrontiert werden, das nie anders aussieht als ein Rammbock, auf den man ein Büffelfell genagelt hat. Man muss dann doch manchmal kichern.
Anders als in der Werbung (und im nachfolgenden Trailer) suggeriert, orientiert sich die Handlung weit mehr an “Moby Dick” von Melville, als an Spielbergs “Jaws”:
Man spürt eigentlich die ganze (recht schlanke) Laufzeit, dass die Macher etwas sagen wollten, ein Anliegen hatten. Der Büffel ist nicht bloß ein Büffel, er ist ein Sinnbild. Für WAS, das bleibt leider nur anerzählt; vielleicht für die Naturgewalt als solche, vielleicht für das Ende männlicher Virilität, oder den endgültigen Untergang des amerikanischen Kontinents als wilde Steppe. Wäre das alles ein weniger “in your face” und durchschaubar inszeniert – vielleicht hätte es mich sogar geschert.
Auch als “reiner” Monsterfilm ist “White Buffalo” bestenfalls mau: Der Büffel kommt zu wenig vor, ist zu schlecht gemacht, und als Gefahr bleibt er reduziert (unsere Helden müssten sich ja nicht mit ihm auseinandersetzen, und arg viel hat er einer Salve Gewehrkugeln auch nicht entgegen zu setzen).
Es tut mir leid um die großen Westerndarsteller, die hier mit tatterigen Gesichtern besseren Zeiten nachsehnen, um die schönen Winterlandschaften, und um den vielleicht letzten “coolen Look”, den Bronson je auf die Leinwand brachte. Aber wer nach symbolisch aufgeladenen Spätwestern sucht, sollte besser weiterhin zu “El Topo”, “High Plains Drifter”, und “Ulzana’s Raid” greifen.
The Butterfly Effect 3: Revelations

Jetzt bin ich mal wieder im Nachteil: Ich habe zwar “Butterfly Effect” gesehen (und fand ihn klasse), aber nicht die D2DVD-Fortsetzung, die dem Vernehmen nach nicht ganz so schlecht ist, wie es D2DVD-Fortsetzungen gewöhnlich sind. Da die Filme aber nur thematisch, nicht jedoch inhaltlich aneinander gekoppelt sind, lasse ich das mal durchgehen.
Der Vorteil einer Fortsetzung von “Butterfly Effect” liegt ganz einfach darin, dass das Konzept beliebig fortführbar ist, an keiner bestimmten Person hängt, und keine großen Spezialeffekte verlangt. Letztlich íst das gesamte Konstrukt der willensinduzierten Zeitsprünge mit all ihren Paradoxien “reine” SF, wie ich sie mir häufiger wünschen würde. Und damit gibt es auch keinen Grund, warum “Butterfly Effect 3” schlechter sein muss als die beiden Vorgänger.
Technisch ist er das zuerst einmal auch nicht: Wo Ashton Kutcher keine Bäume ausreißen musste, blamiert sich auch Chris Carmack nicht. Die Kameraführung ist agil, der Schnitt angemessen flott, ohne lästig zu werden. Die Effekte halten sich in Grenzen, was sich aber immer nach kreativer Entscheidung, nie nach finanziellem Engpass anfühlt. In der Eröffnungsszene wird für das Zielpublikum ein wenig gesplattert, aber im weiteren Verlauf regiert auch hier die Zurückhaltung. Genauso sieht es mit dem Sex aus – es geht einmal richtig zur Sache, und das sogar mit der der sehenswerten “Mistress Malice”, dem “Maskottchen” der After Dark Horror-Reihe, zu der auch “Butterfly Effect 3: Revelation” gehört.
Sam ist diesmal unser Held, und er reist fokussiert in die Vergangenheit, um der Polizei bei der Auflösung von Gewaltverbrechen zu helfen (man hält ihn dort für einen Hellseher). Dabei achtet er tunlichst darauf, nichts zu verändern, um den Zeitstrom nicht zu beeinflussen. Leider kann er die Finger nicht von seinen eigenen Kindheitstrauma lassen, und das geht erwartungsgemäß schief: mit jedem neuen Sprung gerät seine Wirklichkeit mehr und mehr außer Kontrolle.
Die Idee, “Butterfly Effect” mit ein wenig Krimiplot aufzupeppen, ist gar nicht so schlecht, und so lange sich der Film an diese Idee hält, funktioniert er auch. Aber das persönliche Drama von Sam, um das es letzten Endes geht, ist zu dünnes Eis für die überforderte Autorin. Wo das Original noch clevere und tragische Butterfly-Konsequenzen bot, wirkt hier alles schnell vage und behauptet: Sams Kräfte sind zu kontrollierbar (er kann springen, wann und wohin er will), und die Auswirkungen sind größtenteils beliebig, selten aber wirklich schockierend. Er springt, es geht schief, er springt, es geht schief – das ermüdet, weil es nicht nennenswert eskaliert. Zugegeben, der Twist am Schluss ist nicht schlecht (allein deshalb, weil ich ihn nicht habe kommen sehen), aber er bleibt unter dem Strich folgenlos.
http://www.youtube.com/watch?v=PEXCd22TmZA
“Butterfly Effect” ist ein Film über die Konsequenzen von Zeitreisen, und über die individuelle Verantwortung, sein Schicksal anzunehmen, selbst wenn man es verändern könnte. Der Film ist erheblich cleverer konstruiert, als viele Kritiker es wahrhaben wollen (die Abneigung gegen Kutcher mag eine Rolle spielen). “Butterfly Effect 3” ahmt den Stil und die Struktur des Originals brauchbar nach, hat aber letztlich nichts Neues zu sagen, und flüchtet sich in Thriller-Klischees, bei denen das Zeitreise-Element nur noch Dekoration ist. Solide unterhaltsam, aber ohne wirklichen Nährwert.
Wonder Woman
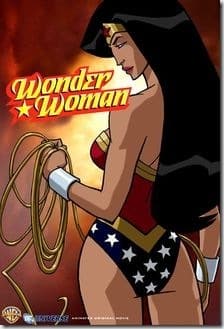
Ich habe ja neulich an anderer Stelle schon mal geschrieben, dass DC in letzter Zeit bei den Zeichentrickfilm deutlich mehr Glück hat als bei den Realverfilmungen (von “Dark Knight” mal abgesehen). Die trauen sich einfach konsequenter, ihre Graphic Novels auszuschlachten, als Marvel es tut (bei denen werden meisten nur die “origin stories” ihrer Figuren zum umpfzigsten Mal aufgewärmt).
Nun ist also “Wonder Woman” dran, und ich habe ein Problem: mythische Heldenfiguren sind nicht so meins. Thor finde ich ja auch albern. Das hat nichts damit zu tun, dass ich Atheist bin: Superhelden passen in meinen Augen einfach besser in einen Science Fiction- als in einen Fantasy-Kontext. Superkräfte sind bitteschön das Ergebnis von radioaktiver Strahlung oder außerirdischer Mutation, nicht aber göttlicher Einmischung.
“Wonder Woman” ist einer zeitgenössischen “Xena: Warrior Princess” damit ähnlicher, als gesund ist.
Als zweiter Stolperstein erweist sich der Aufwand, mit der die “origin story” doch mal wieder durchgekaut wird. Als schert es mich, ob und wie die Amazonen hunderte Jahre auf ihrem paradiesischen Inselchen lebten – ohne nackt zu baden, leider. Bis die eigentliche Handlung in die Pötte kommt, dauert es einfach zu lange.
Und third strike: “Wonder Woman” ist eine Figur ohne wirkliche Motivation, ohne Grundkonflikt. Sie ist kein getriebener Charakter, hat kein höheres Ziel, und kommt sowieso aus privilegiertem Hause. Da liegt wenig Drama drin.
Und so kann die Animation noch so flüssig, das Haar noch so wallend, das Voice Acting noch so überzeugend sein – es packt mich einfach nicht. Die relativ kurze Laufzeit war mir schon zuviel, und ginge es mir nicht gegen das Prinzip – ich hätte das erste Drittel komplett vorgespult.
http://www.youtube.com/watch?v=CD4nskGRHkg
In allen Punkten solide gemacht, aber gänzlich ohne Wow-Faktor. Vielleicht ist das tatsächlich mehr was für Mädchen, wie es vom Wonder Woman-Erfinder einstmals auch gemeint war. Als ausgewachsener männlicher Superhelden-Fan kann ich dem allerdings wenig abgewinnen.
Role Models
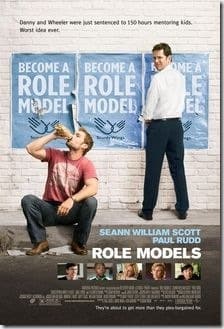
Vorab: “Role Models” ist KEINE von den Judd Apatow-Komödien, die derzeit so populär sind wie seinerzeit die Filme von John Hughes. Der Mann hat einen neuen Comedy-Zeitgeist geprägt, und der Begriff “dick flick” ist untrennbar mit ihm verbunden.
Ich weise deshalb darauf hin, weil “Role Models” sich sklavisch an die Vorgaben des Subgenres hält, und an alle anderen ausgelutschten Klischees, die seit 30 Jahren in Hollywood die Runde machen.
Dabei klingt die Story oberflächlich durchaus interessant: Danny und Wheeler haben mit dem Energydrink-Monstertruck ihres Arbeitgebers Mist gebaut, und müssen Sozialstunden ableisten, in dem sie sich um sozial benachteiligte Jugendliche kümmern. Beide haben keinen Bock drauf, zumal ihnen echte Nervensägen zugeteilt werden: Wheeler muss ein rotznäsiges Ghetto-Kid beaufsichtigen, und Danny wird zum “big brother” eines Nerds, der gerne auf Live-Rollenspiele geht. Hilarity ensues.
Wäre ja alles gut und schön, wenn die Rollenverteilung nicht so vorhersehbar wäre: Danny ist der eher konservative Typ, der bloß erwachsen werden muss (und dem dafür von Szene 1 an die Liebe seines Lebens winkt), während der Partyficker Wheeler ein soziales Bewusstsein entwickelt. Das läuft natürlich in den exakt für diese Sorte Film vorgegebenen Schritten ab:
– Die Helden bekommen Ärger (Grund: sie sind zu pubertär)
– Ein Held verliert die Freundin (Zielsetzung!)
– Die Helden werden zur Sozialarbeit verknackt
– Sie widersetzen sich der Aufgabe
– Die erste Begegnung mit den Kids ist eine Katastrophe
– Die Helden wollen abbrechen
– Sie erkennen die Vorteile, wenn sie das durchziehen
– Sie machen mit Feuereifer wieder an die Arbeit (unehrlich!)
– Es gibt erste Erfolge, die Arbeit macht wider Erwarten Spaß
– Großer Streit, als rauskommt, dass sie Egoisten sind
– Es besteht die Chance zum bequemen Absprung – no way!
– Moralische Kehrtwende: Sie sind für ihre “Jungs” da
– Sieg auf allen Ebenen, die Liebe winkt, sie sind erwachsen
Von diesem müden Schema weicht “Role Models” keine Sekunde ab. Wenn man genug von diesen Filmen gesehen hat, kann man die Ereignisse bis auf die Minute genau vorhersagen.
Trotzdem ist RM kein Totalausfall: Besonders Paul Rudd hat massig Charisma und komödiantisches Timing, und keine Rolle kann Sean William Scott besser als das Party Animal. Die Gags sind solide über die Laufzeit verteilt, nie widerlich (wofür man in solchen Filmen mittlerweile dankbar sein muss), und teilweise sorgt allein der Background des Live-Rollenspiels für Heiterkeit. Die Nebenrollen sind durch die Bank mit den bekannteren Improv-Comedians aus der Szene in und um Los Angeles besetzt, was für so manches lustige Cameo sorgt.
http://www.youtube.com/watch?v=9nWPR7o0AKk
So konsequent, wie der Film sich an die Formel hält, so konsequent vermeidet er daher auch Fehltritte. Für einen brauchbaren DVD-Abend mit der Freundin ist also allemal gesorgt.
American Swing
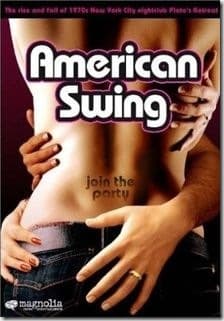
Zum Abschluss des Marathons mal wieder eine Doku. Heute geht es um ein sehr spezielles Thema: Aufstieg und Fall des Swinger-Clubs “Plato’s Retreat” im mondänen New York der 70er Jahre.
Im Gegensatz zu vielen Dokumentationen, die ein zeitlich und örtlich sehr begrenztes Thema beackern, stand den Machern von “American Swing” ausreichend Bildmaterial zur Verfügung: “Plato’s Retreat” war in den 70ern eine echte Sensation, und es wurde in den Nachrichten oft und gerne darüber berichtet. Er war wie das “Studio 54” – nur mit mehr Sex (wenn das möglich ist). Außerdem leben viele der “Augenzeugen” noch, und lassen sich bereitwillig interviewen.
Wenn man das neue, frische und anständige New York der Post-Giuliani-Ära mal besucht hat, dürfte man schockiert sein über das Bild, das die Metropole hier (noch) bietet: ein kokainschwangerer, versiffter, verlotterter Moloch, in dem Sex, Verbrechen und Partys eine ungesunde Troika bildeten. Es ist die Kultur, an die wir Männer wie John Belushi verloren haben, und John Holmes. Alle waren hip – weil man halt hip zu sein hatte (Woody Allen hat das damals auf sehr zarte Weise ja perfekt analysiert). Es war die Ära nach der Erfindung der Pille, aber vor der Entdeckung von AIDS. Man ging in Pornofilme, las “Screw”, und fickte fremd, ohne sich etwas dabei zu denken. Schnauzbärte, Schamhaare, Schlaghosen – alles deluxe.
“American Swing” ist keine Zelebrierung der Freien Liebe, wie die Hippies sie verstanden: Sex ist hier Konsum, Gruppendruck, Leistung. Das “join the party” des Posters ist keine Einladung – es ist eine nachdrückliche Aufforderung.
Der vielleicht erstaunlichste Aspekt von “American Swing”: in die Jahre gekommene, stockkonservativ wirkende Menschen berichten nostalgisch von ihren Sexkapaden, als redeten sie von ihrem Schulabschluss, oder einem Sommer im Camp. Der Sex wird als so allgegenwärtig dargestellt, dass die Hygiene der Matratzen und die Qualität des Buffets in “Plato’s Retreat” höheren Stellenwert hat. Als wäre ein Abend Rudelbums mit einem Pauschalurlaub vergleichbar.
Problematisch ist natürlich, dass “American Swing” wenig über die gegenwärtige Kultur auszusagen hat (anders als z.B. “Bigger Stronger Faster”). Wenn man sich nicht aus kulturhistorischen oder einfach voyeuristischen Gründen für dieses Thema interessiert, geht der Nährwert gleich gegen Null.
Mir hat’s gefallen – but your mileage may vary…

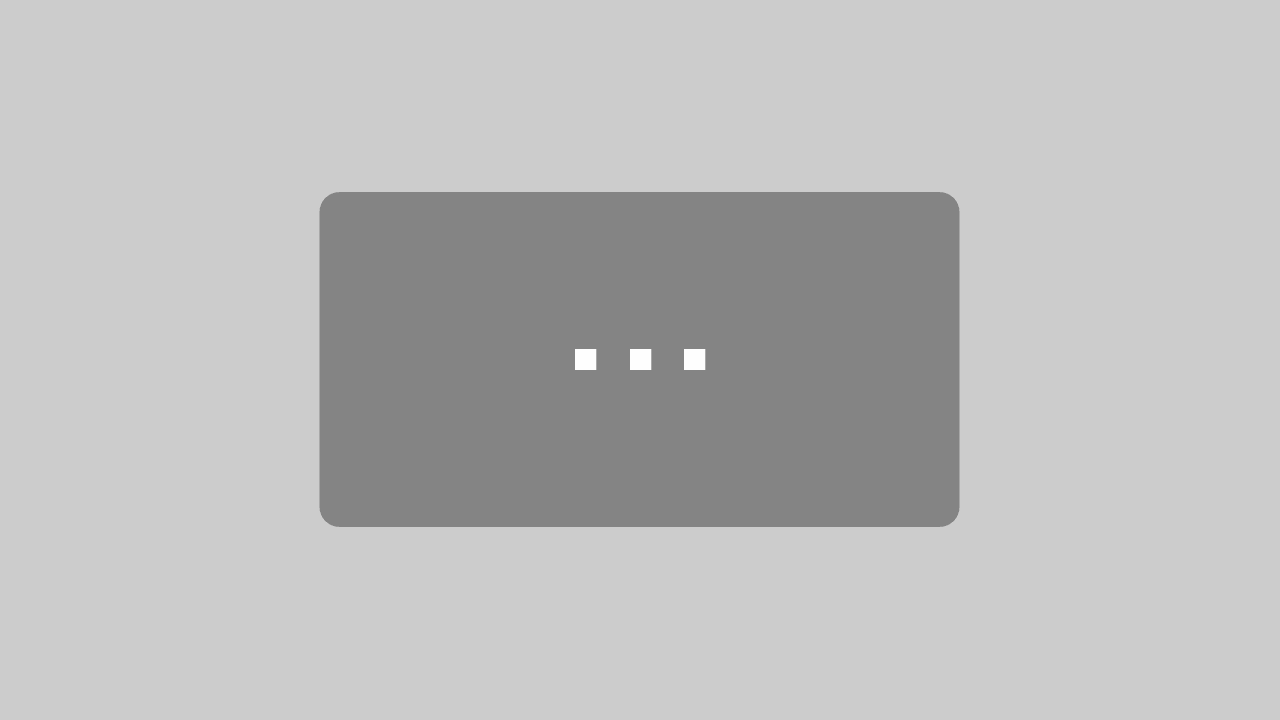
Mal ganz kurz und knapp zum Büffel: Sowohl als Western als auch Horrorfilm ein Totalflop, mit einem Viech, das aussieht und sich bewegt, als würden normalerweise Kleinkinder auf ihm reiten, nachdem sie ‘nen Euro eingeworfen haben. Zum vergessen…
Ich fand den ersten Butterfly Effect auch ganz ordentlich, obwohl ich Kutcher echt nicht mag. Allein schon der mal total anders als in allen anderen Ami-Filmen dargestellte Grufti war den Eintritt wert:-))
Und an Apatows Stelel würde ich es extrem beleidigend finden, mit einem Begriff wie “dick Flick” in Verbindung gebracht zu werden…
“keine Rolle kann Sean William Scott besser als das Party Animal.”
Naja, er hatte ja bisher auch wenig Gelegenheit, eine andere Rolle auszuprobieren: Die American Pie-Reihe, Road Trip, Dude, Where’s My Car?, Role Models, mein Gott, 50% der Rollen die er gespielt hat unterscheiden sich einzig und alleine im Namen und selbst die restlichen Rollen sind sich ähnlich. Wenn irgend ein Studio ein Pary Animal sucht wird nicht gecastet sondern erstmal Sean angerufen.
Aber “Charging…Roaring…Breathing Fire and Hell…” fetzt!
@Panzerführer
Klingt wie ‘ne beliebige Strophe eines Running-Wild-Songs 🙂
Ergänze meinen eigenen Kommentar…
Jetzt fällt’s mir ein, von Running Wild GAB’s sogar einen Song namens “White Buffalo” (der leider nix mit dem Film zu tun hat…)
@ Acula: Eine Rocknummer auf dem Soundtrack hätte diesem Film eigentlich das Tüpfelchen auf dem i verpasst…
@Mahwa:leider nur zu wahr. In “Welcome to the jungle” fand ich ihn richtig gut und ich glaube, der kann noch viel mehr, wenn man ihn lässt
Danke für zwei (im Kontext) sehr witzige Verschreibsel: Bei Butterfly-Effect hilft Sam der Polizei bei “der Auslösung von Verbrechen” und bei Role Model haben die Jungs “einen Bock” auf den Job. Ansonsten fand ich es wie immer ganz wunderbar, dass ich jetzt weiß, um welche Filme ich einen Bogen machen sollte. Danke und weiter so!
@ PAL: Danke, ist korrigiert. Und danke für das Lob. Habe ich den Kram wenigstens nicht für die Tonne geschrieben.
@ Heino: “Welcome to the Jungle” war generell ein ganz toller Film.
@Vogel
Der war ja auch mit The Rock und der macht sogar “Southland Tales” erträglich 😉
Und “Be Cool”…
Stimmt, “Welcome to the jungle” macht richtig Spass. Kaum zu glauben, dass der von Peter Berg ist (Hancock my ass, man). Alleine Christopher Walken ist schon mal wieder eine Schau. Und The Rock kann echt einiges, sogar im reichlich überflüssigen “Get Smart”
“Hancock my ass” ? Very Bad Things war doch viel schlimmer…