Buch-Kritik: „Sonky Suizid“ von Gero Reimann
Themen: Neues |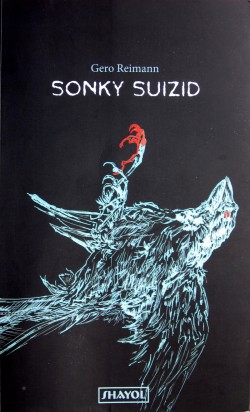 „Jeder Satz würde ihm aus dem Mund gerissen werden und die Bedeutungen der Wörter, der Sätze, der Zeichen, die Bedeutung des Codes, würde sich gegen das wenden, was er aussprechen wollte, gegen das, was er fühlte.“
„Jeder Satz würde ihm aus dem Mund gerissen werden und die Bedeutungen der Wörter, der Sätze, der Zeichen, die Bedeutung des Codes, würde sich gegen das wenden, was er aussprechen wollte, gegen das, was er fühlte.“
Ich bespreche selten Bücher, noch seltener Romane. Das kommt daher, dass ich kaum noch Romane lese. Es fehlen mir die Zeit und die Ruhe dazu. Das führt auch dazu, dass ich nicht besonders kompetent bin, komplexere Romane zu besprechen, weil mir das schiere Volumen des notwendigen Backgrounds abgeht.
Bei „Sonky Suizid“ fühle ich mich allerdings verpflichtet, handelt es sich doch um den 1983 geschriebenen, aber erst 2011 posthum (der Autor verstarb 2009) veröffentlichten „großen Roman“ des Dick-Fetischisten und Feuilleton-Kombattanten Gero Reimann. Seine Fehde mit dem Übersetzer Joachim Körber war ein Highlight des Fandoms der 80er und wurde von mir kürzlich und ausführlich wieder aufgewärmt. Reimann hatte zeit Lebens keine Probleme, die Arbeit anderer Leute in Grund und Boden zu treten und sich selbst dabei als unverstandenes Genie zu sehen, das von der Verlagsmafia konspirativ unterdrückt wurde. Gerade deshalb schien mir „Sonky Suizid“ geeignet, um Reimann an seinen eigenen Maßstäben zu messen. Ist uns hier ein deutscher Dick entgangen, ein Burroughs gar? Oder liegt ein weiterer Beleg dafür vor, dass „besser wollen“ und „besser können“ eben doch durch einen breiten Canyon voneinander getrennt sind?
Ich habe vier Monate gebraucht, um mich – teilweise Seite für Seite – durch “Sonky Suizid” zu arbeiten. Oder sollte ich lieber “kämpfen” sagen?
„Gab es diese vier Menschen überhaupt, oder waren sie nicht vielmehr nur schemenhafte, äußerst ungenaue Ausgeburten einer krankhaften kollektiven Phantasie, heraufbeschworen angesichts einer allgewaltigen Angst vor totaler Vernichtung durch Atombomben oder anderen drohenden Gefahren? Das Gleißen und Toben der entfesselten Materie war jederzeit in den Gedanken der Menschen gegenwärtig.“
Den Inhalt will ich nur grob mit ein paar Sätzen umreißen, denn letztlich ist er Reimann augenscheinlich egal, ein so unnützes wie mageres Gerüst: der ungeschlachte Sonky Suizid stapft mit zwei Munitionskisten aus den Weltkriegen durch Hannover – er ist ein Getriebener, ein lebender Toter mit nachwachsenden Körperteilen und schwammigen, ständig wechselnden Erinnerungen. Inmitten von bizarren Katastrophen veranstaltet er das, was wir heute vielleicht Raves nennen würden, erzählt seinen weiblichen Anhängern vermutlich erfundene bis erlogene Anekdoten und sucht eine Chance, vom Krebs zerfressen und vom Tod verlassen, endlich seinen Körper los zu werden. Vielleicht ist er aber auch bloß verrückt und aus einer Anstalt entflohen.
250 Seiten gönnt sich Reimann für diese vergleichsweise kurze Reise Sonkys vom Waldrand in die Stadt, zum Krankenhaus, zur alten Halle, zur Mietwohnung, zur Kneipe und zum Schwimmbad. 250 Seiten, in denen alle anderen Charaktere ungreifbar wie Chiffren (und oft genug sichtlich an veralteten Rollenklischees entwickelt) in das wirre Geschehen hinein und wieder hinaus flirren. Der arrogante Chefarzt, der junge Revoluzzer, die spießige Sympathisantin – niemand darf mehr sein als Stichwortgeber für die „stream of consciousness“-Monologe, Gedankengänge und Proklamationen einer Hauptfigur, die in ihrer Hässlichkeit, Leere und Amoral wohl Sympathie für das Andersartige wecken soll, aber unter dem Strich doch nur hässlich, leer und amoralisch bleibt.
„Wie sind ineinander verflochten, miteinander verkabelt, vergesellschaftet – eben tot. Sind das All, sind Tot-all.“
„Sonky Suizid“ versucht verzweifelt, ein Anti-Roman zu sein, der dem banalen Unterhaltungsanspruch des Lesers widersteht und ihn zum Mitdenken, Mitreisen und Mitfühlen zwingt. Keine Heldenreise nimmt uns an die Hand, kein erkennbarer Plot, kein verlässlicher Protagonist – selbst die Genre-Elemente sind so vage und angerissen, dass die Klassifizierung als „Science Fiction“ wohl eher Reimanns Liebe zu Dick geschuldet ist als der tatsächlichen Schublade, in die „Sonky Suizid“ gehört. Das Buch möchte ein luzider Traum sein, ein Horrortrip, eine asymmetrische Alternative zur geordneten Welt, frei assoziiert und alle Kategorien sprengend.
Leider ist es primär ein eitles, überlanges, mäanderndes Traktat, das gerade in seinem holperigen Bemühen, Relevanz zu proklamieren, praktisch nichts über die Entstehungszeit und seinen Autor hinaus zu sagen vermag. Es ist durchzogen vom Selbsthass eines Deutschen, der überall noch die Gasöfen wittert und von einer Humorlosigkeit, die den echten ideologischen Fanatiker auszeichnet. Wer sich auf “Sonky Suizid” einlässt, hat wahrlich nichts zu lachen.
„Nur ein deutsches Hirn kann im Tod den einzigen Weg zu einem besseren Leben sehen.“
Die apokalyptische Welt, die Reimann präsentiert, ist weder futuristisch noch utopisch. Es ist Hannover anno 1983, gesehen durch grauen Brillengläser der Kapitalismuskritik, des Punk, des gescheiterten Umsturzes und der Umweltverschmutzung. Es ist die durch und durch hässliche Gegenwart, wie sie wohl nur ein Kommunist zu sehen vermochte, der als Lehrer verbeamtet das System genießen konnte, ohne es mögen zu müssen. Reimanns Wahrnehmung lässt sich komplett mit dem Zitat des Punks (Hannes Jaenicke) in Schenkels „Abwärts“ zusammen fassen: „Alles kaputt. Das ganze System“. Freiheit für Nicaragua – und 35 Stunden-Woche! Die Tatsache, dass Reimann damals Krebs hatte, dürfte seine Weltsicht nicht signifikant aufgehellt haben.
„Das typische Junglehrer-Gewäsch (…). Einige gaben sich Reformen gegenüber sehr aufgeschlossen. Dabei hatten die Reformen sich zu jenem Zeitpunkt schon längst als Mittel reiner Leistungssteigerung enttarnt. Das ideologische „sozialdemokratische“ Emazipationsgeseiere beiseite gelassen, konnten die alten Hierarchien glatter arbeiten als vorher.“
Es ist zäh und unbefriedigend, wie komplett freudlos Reimann die Welt sieht – und wer sie nicht sieht wie er, ist schon lange tot oder wurde vom System gefressen, ohne es gemerkt zu haben. In endlosen Tiraden ergeht sich der Autor über die Unerträglichkeit dessen, was wir als Wirklichkeit wahr nehmen. Er möchte uns seine Wahrheit zeigen und übersieht, dass es eben nur seine ist. Die Allgemeingültigkeit, die Nachvollziehbarkeit, das andockbare Element, das gute Prosa ausmacht, ist Reimann fremd. So wütend er auch wettert, dass wir die Augen aufmachen müssen – wir können nicht sehen, was er sieht. Weil wir nicht seine Brillen tragen.
„Was mich entsetzte und lähmte, war diese unerbittliche Macht, mit der aus jedem noch so irrwitzigen Geschehen von den Medien unter Ausnutzung der Ängste der Leute die Gesellschaft sich immer wieder regenerierte und mit der es ihr gelang, noch den größten Wahnsinn (z.B. die Rassentheorie) in eine für die Leute sinnerfüllte Praxis des Gewährenlassens und Handelns umzusetzen.“
Über den Mangel einer tatsächlichen Geschichte und die frustrierende „No future“-Attitüde hinaus nervt Reimann auch durch völlige Disziplinlosigkeit: besoffen vom eigenen Sprachschatz verpackt er die immer gleichen Platitüden in immer neue Metaphern und Formulierungen, oft drei, vier mal in direkter Folge. Er bläht sein Dogma auf, bis man sein Bier abstellen und sagen möchte: „Alter! Ich hab’s verstanden!“. Damit er endlich Ruhe gibt. Reimann vertraut weder seiner Prosa noch seinen Lesern und verliert dadurch jedes Gefühl für Verhältnismäßigkeit. Botschaften werden nicht klarer, wenn man sie schreit. Und Reimann schreit am laufenden Band.
„Sie fühlten die Katastrophe als Bestandteil ihrer abgestorbenen Leiber, mit denen sie sich jeglichen Perversionen hingeben konnten, eingebettet in Sonkys privates Elend, und schauten gierig in sich hinein, rissen sich die Haut von den Körpern, um noch mehr Schrecken erhaschen zu können.“
Es ist das Übermaß an Proklamation und der Mangel an tatsächlicher Erzählung, der „Sonky Suizid“ zu einer Tortur macht, von der man immer nur wenige Seiten am Stück schmerzfrei konsumieren kann. Viel zu sagen hat Reimann letztlich nicht, aber er sagt es penetrant und immer wieder. Alles kaputt. Das ganze System.
Es ist nicht so, dass Reimann ein miserabler Autor wäre – sein Wortschatz ist üppig, sein Stil bildstark, und immer wieder (besonders bei den Lebenserinnerungen der Figuren) gelingen ihm Szenen und Sequenzen, die eines besseren, strafferen Romans würdig wären. Was fehlt, ist ein Lektor – bzw. dem Vernehmen nach die Einsicht Reimanns, dass so etwas überhaupt nötig ist. Etwas mehr Stringenz in der Story, etwas weniger Redundanz in der Narrative, etwas mehr Fokus in der Dramaturgie – aus “Sonky Suizid” hätte eine schräge, vielleicht 100 Seiten schmale SF-Novelle werden können, die keine 28 Jahre bis zur Veröffentlichung im Schrank des Autors Staub angesetzt hätte.
Fazit: Ein Roman, den man allenfalls aus akademischem Interesse am Zeitkolorit lesen kann – oder aus masochistischer Neugier, die schwer bestraft wird.
Zum Abschluss seien mir zwei Anmerkungen erlaubt: Shayol ist ein Kleinverlag, dem ich den heftigen Kaufpreis von 17,90 Euro ebenso wenig vorwerfe wie die multiplen Rechtschreibfehler, die augenscheinlich in 25 Jahren auch vom Autor nicht entdeckt wurden. Solche Niggeligkeiten werden mehr als aufgewogen durch ein kluges und detailreiches Vorwort von SF-Urgestein Winfried Czech.
Aber die Krikelkrakel-Illustrationen im Buch, die weder Stimmung schaffen noch besonders aussagekräftig sind, fand ich überflüssig bis nervig – zumal eine davon sich augenscheinlich David Hasselhoff zur Vorlage nahm:
Darüber hinaus ist es ein einziger Buchstabe, der „Sonky Suizid“ fest in den frühen 80ern verankert und den man durchaus hätte ändern können, ohne dem Autor in die Parade zu fahren:
„Harald vilmte“
Genau. Vilmte. So nannte man das in der Frühzeit der Videokameras, um die auf Band gedrehten „Vilme“ von den „Filmen“ auf Zelluloid abzugrenzen. Hat man dann ganz schnell wieder gelassen.


Kann sein, dass die Bilder in dem Buch schlicht fehl am Platze sind. Rein losgelöst mag ich sie (Cover und Portrait) sehr – toller Zeichenstil, der sicher nicht jedem gefällt, aber “Krikelkrakel” ist wirklich was anderes.
“Kann sein, dass die Bilder in dem Buch schlicht fehl am Platze sind. Rein losgelöst mag ich sie (Cover und Portrait) sehr – toller Zeichenstil, der sicher nicht jedem gefällt, aber “Krikelkrakel” ist wirklich was anderes.”
Na ja… beim Cover macht es von der Gestaltung betrachtet noch Sinn, aber das Portrait ist schon etwas überkandidelt. Zumal es nicht nur aussieht wie der Hoff, sondern wie der böse Zwilling vom Hoff mit seinem Zwirbelbart… 😛
Das “vilmte” hat mich erschüttert… davon hab’ ich zum ersten Mal gehört…
Allein die Zitate sagen schon alles, was man über das Buch wissen muss. Das hätte ich schon nach dem ersten Absatz in der Mülltonne entsorgt.
Allerdings. Wie spricht man das denn aus?
Ich nehme mal an wie Video
Waren Sonkies bei Pratchett nicht die Verhüterli……?
@milan: muss ja wohl, sonst könnte man ja rein akustisch “filmte” und “vilmte” nicht unterscheiden.
Das Cover finde ich große Klasse und sehr wirkungsvoll. Ansonsten war und ist Reimann kein Autor, den ich lesen möchte. Aber schön, dass sich mit Jakob Schmidt so ein engagierter “Nachlassverwalter” gefunden hat!
Die Zitate, die du ausgewählt hast, laufen deinem positiven Urteil über die Sprachgewalt eher zuwider. (Über etliche der Sätze würde ich sagen: das ist nichtmal schriftdeutsch im engeren Sinne.) Sind das negative Extrembeispiele?
Wollt’s auch grad wie Matthias sagen – die Zitate klingen für mich auch eher nach einem katastrophal überladenen Stil, der vielleicht viele verschiedene Worte kombiniert, aber nicht wirklich Sprachmächtigkeit, also die Fähigkeit im Umgang mit ihnen, belegt.
Liest sich wie Clive Barker.
“Ich bespreche selten Bücher, noch seltener Romane. Das kommt daher, dass ich kaum noch Romane lese. Es fehlen mir die Zeit und die Ruhe dazu.”
hast du keene Toilette mit Regal gegenüber oder ne Wanne? ideale Leseorte. stets einen Roman im Badezimmer!
erinnert mich daran, wie ich mich durch Eccos “Pendel” quälen wollte…
Bin nie über Seite 97 hinaus gekommen.
@ Matthias/DMJ: Das hätte ich vielleicht klarer machen sollen – die Zitate sollen in der Tat eher die Probleme dokumentieren, die ich mit Reimanns Stil hatte. Dass er an anderen Stellen durchaus prägnant schreiben kann, wird dabei nicht berücksichtigt.
@comicfreak
So ging’s mir beim “Namen der Rose”. Gibt ja zum Glück ‘n Film von 🙂
Oh Gott, das klingt ja furchtbar. Die Textstellen lesen sich so, als ob da jemand unbedingt total bedeutungsvoll klingen wollte und dabei jämmerlich am Gewicht der Worte erstickt ist. Respekt fürs Durchhalten, Wortvogel. Und David Hasselhoff ist echt genial! 😀
Eco liest sich doch recht gut, eventuell zu viele Fremdwörter, aber immer sehr ordentlich geschrieben.
@ Mencken
auf erwähnter Seite war immer noch unklar,
wer/was /wo / wann /warum der ich Erzähler war.
Dann hat’s mich nicht mehr interessiert.
@Comicfreak: Zugegeben, der Einsteig ist immer anstrengend, aber hier ging es ja um die Sprache und in der Hinsicht kann man sich bei Eco eigentlich nicht beklagen.
@Michael, #12:
Der Wortvogel liest durchaus auf dem Thron:
https://wortvogel.de/2012/02/klolekture/
Mir gefällt’s, aber das versteht sich ja wohl von selbst.
Andererseits bin ich auch nicht böse über den Verriss, wenn ich das Buch noch nicht kennen würde, würde ich es mir jetzt wahrscheinlich kaufen.
Anmerken möchte ich nur, dass das Buch aus gutem Grund nur eine Perspektive darstellt – es ist ja eben kein theoretisches Manifest über die Verfasstheit der Welt, sondern ein Roman darüber, wie die Welt einem entgegenschlagen kann und wie man sie empfinden kann. Man muss das nicht nachvollziehen wollen, aber es ist kein Mangel des Romans, dass er konsequent in einer Perspektive (so zersplittert die auch sein mag) verbleibt.
@ Jakob: Auch wenn die Perspektive gewollt ist, kann sie durchaus ein Mangel sein. Mich würde aber ehrlich deine etwas ausführlichere Meinung zum Buch interessieren.
Nein, das sehe ich nicht ein, dass ein konsequent durchgehaltene Perspektive ein Mangel an einem Roman sein soll, nur weil du ein Buch aus so einer Perspektive nicht gerne liest. Du kannst das Buch ja gerne verreißen und dich dabei fragen, wer ein Buch lesen will, das aus einem solchen Blickwinkel geschrieben ist, aber du kannst nicht behaupten, dass ein Buch, dass aus so einem Blickwinkel geschrieben ist, prinzipiell schlecht sein muss.
Warum ich das Buch großartig finde, kann ich gerne ausführlich darlegen: Einen ganz großen Teil macht die ausdrucksstarke Sprache aus – viele der von dir zitierten Passagen finde ich ganz wunderbar, und dann gibt es noch Formulierungen wie die über das Licht, das die Waren in den Schaufenstern für die Nacht übrigließen – völlig eigenwillige Bilder, die sich mir sofort erschließen. Auch humorlos finde ich das Buch keineswegs – die Szene, in der Harald gegen das Schillerdenkmal prallt, Sonkys Verhältnis zu seiner Tante Dorrit (die göttliche Erinnerung an den Furz), die ganze abstruse Situation, dass nach der apokalyptischen Fete im Bad das Leben weitergehen, Geld herangeschafft, Pornofilme gedreht werden müssen – das ist zwar alles schmerzhaft, aber alles auch ungeheuer komisch.
Auch den Fanatismus und die Verbissenheit, die du bemängelst, kann ich nicht sehen – ich sehe das Buch als rabiate Selbstzerlegung des politischen Idealismus der 68er, als Ausdruck der Erfahrung, selbst immer drinzustecken in einem widerwärtigen Todessystem. Reimann drängt ja nun auch keine Lösung und eigentlich auch keine Botschaft auf, wie man es von einem ideologischen Fanatiker erwarten würde – er führt einem die Wirklichkeit einfach nur gebrochen durch das Bewusstsein des eigenen Tods und das Bewusstsein der Todesindustrie des Holocaust vor.
Den “Selbsthass eines Deutschen, der immer noch die Gasöfen wittert” – spätestens das ist der Kritikpunkt deinerseits, der mich wohl zum Kauf bewegt hätte. Ich goutiere zwar auch mit Vergnügen “Iron Sky” oder “Captain America”, ich bin aber auch froh über die wenigen literarischen und filmischen Werke, denen die Erschütterung durch NS und Holocaust anzumerken ist. Es ist vielleicht nicht unbedingt angenehm, aber gut, dass es dann und wann noch Autoren gibt, die in vollem Ernst ein Entsetzen über den NS artikulieren können und ihn nicht nur als abgeschlossenes Kapitel der Geschichte und Lieferant für lustige Indiana-Jones-Bösewichter betrachtet. Klar macht das keine gute Laune. Das steht allerdings auch schon im Klappentext. Imre Kertesz macht auch keine gute Laune und ist trotzdem ein unglaublich guter Autor.
Dass du den Autor als “ideologischen Fanatiker” abstempelst, nur weil er seine Abscheu gegen das Deutschland der 80er, in dem er lebte, zum Ausdruck bringt, finde ich dann auch als Einziges ein bisschen schäbig an deiner Rezension. Böswillig könnte man auch herauslesen: “Wer heute immer noch schlimm findet, was in Deutschland vor 70 Jahren passiert ist, ist ein Spielverderber und Miesmacher, mit dem wir nichts zu tun haben wollen.” Nun ja, in dem Fall wäre ich dann tatsächlich auch lieber ein Spielverderber und Miesmacher.
Ich hatte das Glück, noch ein bisschen später geboren zu sein als Gero Reimann und nicht ganz so viel Nazimief mit abbekommen zu haben. Trotzdem hat das Buch für mich ziemlich genau getroffen, wie Deutschland sich für mich (in den frühen 90ern) anfühlte. Eng, verlogen, autoritär, voll unterschwelliger Gewalt. Ich glaube gern, dass es sich nicht für alle so angefühlt hat, und ich will nicht jedem zumuten, das nachzuerleben. Aber dieses Erleben zu artikulieren, hat nichts mit Selbsthass und nichts mit ideologischer Verbohrtheit zu tun, sondern einfach mit Wachheit und Ausdrucksfähigkeit.
Kurz: Ich finde, du hast ziemlich viele Sachen gut getroffen, die für mich Kennzeichen von Wachheit, Ausdrucksfähigkeit und ironischerweise Lebendigkeit des Autors sind – weil er offenbar als jemand schrieb, der sich nicht gegen Tod und Massenmord abgestumpft hat, sondern beide empfinden und dieses Empfinden artikulieren konnte.
@ Jacob: Ich bin unschlüssig, ob du mich nicht verstehst oder nicht verstehen willst.
“aber du kannst nicht behaupten, dass ein Buch, dass aus so einem Blickwinkel geschrieben ist, prinzipiell schlecht sein muss.”
Das habe ich auch nicht behauptet. An keiner Stelle. Ich sage vielmehr: Auch wenn die Perspektive des Romans gewollt war, muss sie deshalb nicht gut, richtig oder praktikabel sein.
“Wer heute immer noch schlimm findet, was in Deutschland vor 70 Jahren passiert ist, ist ein Spielverderber und Miesmacher, mit dem wir nichts zu tun haben wollen.” – auch das habe ich weder gesagt noch impliziert. Es ist ein ganz bösartige Unterstellung, die mit dem von dir gewählten Begriff “schäbig” sehr gut beschrieben ist.
Wir werden da sicher auf keinen grünen Zweig kommen – du findest die von mir zitierten Stellen toll? Dann haben wir gänzlich verschiedene Ansprüche an Literatur. Das ist auch in Ordnung. Ich würde dich nur bitten, die Form zu wahren und dich nicht stellvertretend für Reimann in Schlachten zu stürzen, die du nicht gewinnen kannst – weil es eben um Geschmack und Meinung geht, nicht um Fakten.
Ach ja: Die Sache mit den Gasöfen hast du auch falsch verstanden. Ich habe nichts gegen Vergangenheitsaufarbeitung, auch wenn das nicht in das Bild passt, das du dir augenscheinlich von mir gemacht hast – eines meiner Lieblingsbücher ist “Slaughterhouse 5” von Vonnegut.
Tut mir leid, ich muss eben bei näherer Auseinandersetzung doch feststellen, dass ich selber etwas gekränkt bin von Passagen, bei denen du Gero Reimann doch sehr direkt verächtlich machst. Ich hab ihn ja nur vom Telefon gekannt und es sehr bereut, ihn nie persönlich getroffen zu haben. Das war für mich eben eine sehr eindrückliche Erfahrung, ebenso wie die Auseinandersetzung mit seinem Roman. Andererseits kann ich eine gewisse Scharfzüngigkeit verstehen, wenn man sich pflichtschuldig durch 250 Seiten gequält hat, ohne das Geringste aus der Lektüre herausziehen zu können.
Sei’s drum, als von Verlagsseite interessierte Partei will ich jetzt auch nicht in den Ruf kommen, Kritikern blöde zu kommen. Ich wollte dir auch nicht unterstellen, dass du Vergangenheitsaufarbeitung ablehnst (obwohl Slaugtherhouse 5, ein großartiger Roman, gerade in der Beziehung streckenweise doch schwer missglückt ist – aber wahrscheinlich konnte Vonnegut damals nicht recht abschätzen, was für einen unseriösen Gewährsmann er sich mit dem “Historiker” David Irving angelacht hatte), ich schrieb ja “Böswillig könnte man auch herauslesen”, also: Wenn man das, was du geschrieben hast, explizit böswillig zu deinem Nachteil auslegt. Ist allerdings auch mal ganz ehrlich gesagt eine faire Erwiderung auf deine (in meinen Augen seinerseits recht böswillige) Unterstellung, dass der Autor von “deutschem Selbsthass” getrieben würde.
@ Jakob: Ich habe Reimann nicht verächtlich gemacht, das ist Unfug. Und du bist nicht Reimann. Ich habe dem Roman und dem Autor den Respekt erwiesen, das Werk komplett zu lesen und ausführlich meine Meinung darzustellen, statt es bloß mit “nihilistischer Scheiß” abzuwerten. Wenn dir meine Meinung nicht gefällt, ist das deine Tür, vor der du fegen musst.
Ich denke, Czech sagt es im Vorwort auch sehr schön: “Unversöhnlich, hoffnungslos, frei von jeglicher ironischer Instanz.”
Dass du das Buch gelesen hast und deine Meinung dazu begründet dargelegt hast, habe ich ja nun auch hinlänglich gewürdigt.
Ich verstehe jetzt nicht ganz, warum du mich aufforderst, vor meiner eigenen Tür zu kehren und dich nicht mit meiner Meinung zu dem Buch und deiner Rezension zu behelligen, nachdem du mich zuvor explizit nach selbiger gefragt hast. Ich habe das als Diskussionseinladung aufgefasst, ohne die hätte ich es bei meinem einen bescheidenen Einwand belassen.
Ist wohl einfach ein Fall von gescheiterter Kommunikation, kommt im Internet ja häufig vor.
@ Jakob: Du bist wirklich außergewöhnlich renitent und es gehört schon ein Talent dazu, wirklich JEDE Aussage brutalstmöglich misszuverstehen. Ich frage einfach testhalber nach: Wo habe ich dich aufgefordert, mich nicht mit deiner Meinung zu behelligen? Nach der habe ich in der Tat gefragt. Zu dem Buch. Ich habe aber nicht gefragt, ob du meine Kritik (albernerweise) für schäbig hältst.
Übrigens sollte dir auffallen, wie meine Leser weiter oben auf die zitierten Zeilen von Reimann reagieren – das Problem mit der Schreibe scheine nicht nur ich zu haben…
Na ja, lassen wir das.
“Aber die Krikelkrakel-Illustrationen im Buch, die weder Stimmung schaffen noch besonders aussagekräftig sind, fand ich überflüssig bis nervig – zumal eine davon sich augenscheinlich David Hasselhoff zur Vorlage nahm…”
Das Bild kommt mir sehr bekannt vor. Anfang/Mitte der 90er Jahre gab es im redaktionellen Teil von “Professor Zamorra” mal ein paar Bilder davon, wie sich die Leser die PZ-Charaktere vorstellen, und ich bin der Meinung, daß es da mal das gleiche Bild zu sehen gab (sollte wohl der Prof oder Sid Amos sein…).
@ Filmi: Faszinierende These. Wäre cool, wenn man das verifizieren könnte…
@OnkelFilmi:
Ich habe die Originale eigenhändig eingescannt, die sahen für mich nicht kopiert, durchgemalt oder was auch immer aus, wenn du das meinst. Das Gehirn macht aus ähnlichen Bildern im Kopf ja oft nachträglich gleiche. Gerade bei einem Gesicht, dass als ähnlich empfunden wird.